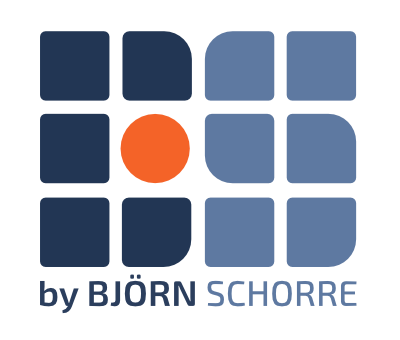Disziplinvernetzung meistern: Das 14. Prinzip im Systems Engineering
SE-Prinzip 14 im Fokus: Warum Systems Engineering nicht nur technische Architektur, sondern Organisationssteuerung braucht
Systems Engineering (SE) ist weit mehr als nur technische Systemgestaltung: Es ist eine Disziplin, die über den gesamten Lebenszyklus von Systemen hinweg Verantwortung übernimmt – von der Konzeptphase bis zur Außerbetriebnahme. In der Weiterentwicklung von SE-Prinzipien wurde das vierzehnte Prinzip definiert als:
„Systems Engineering ist dafür verantwortlich, die Interaktionen zwischen den technischen Disziplinen innerhalb der Systementwicklung zu verwalten.“
SE-Prinzip 14 nach INCOSE
Dieses Prinzip lenkt den Blick darauf, dass nicht nur Schnittstellen zwischen Subsystemen gesteuert werden, sondern dass auch die Schnittstellen zwischen Fachdisziplinen – wie Mechanik, Elektronik, Software, Test, Produktion – und zwischen Organisationseinheiten aktiv gemanagt werden müssen.
Bedeutung und Motivation
In großen und komplexen Projekten entstehen oft Konflikte oder Ineffizienzen, weil Disziplinen isoliert arbeiten, unterschiedliche Terminologien nutzen, Ziele nicht ausreichend abgestimmt sind oder Informationsflüsse schlecht gestaltet sind. Wenn jede Disziplin quasi „in ihrem eigenen Universum“ operiert, drohen Missverständnisse, Redundanzen oder falsche Annahmen.
Das 14. Prinzip signalisiert: Der Systems Engineer – oder auch die technische Projektleitung – trägt Verantwortung dafür, die Interaktion der Disziplinen bewusst zu steuern – also Kommunikationswege zu etablieren, gemeinsame Verständnisräume zu schaffen und integrative Strukturen zu entwerfen.
Kernelemente des Prinzips
-
Organisationsstruktur und Systemstruktur abstimmen
Damit die Systemarchitektur optimal funktioniert, sollte idealerweise die Organisationseinheit die Disziplinen so aufbauen oder vernetzen, dass sie die Systemintegrationsziele erreicht werden können. -
Terminologie und Semantik synchronisieren
Disziplinen verwenden unterschiedliche Begriffe für ähnliche Konzepte. Systems Engineering hat hier die Rolle eines Übersetzers und Mediators, um gemeinsame Begrifflichkeiten und Schnittstellendefinitionen zu gewährleisten. -
Kommunikations- und Koordinationsprozesse etablieren
Regelmäßige Synchronisationsmeetings, integrierte Reviews (disziplinübergreifende Reviews), abgestimmte Dokumentationsformate und gemeinsame Tools sind wichtig, damit jede Disziplin relevante Informationen erhält und einbringt. -
Konfliktmanagement zwischen Disziplinen
Wenn Disziplinziele in Konflikt geraten – z. B. Performance vs. Kosten vs. Fertigungsfreundlichkeit – muss Systems Engineering moderierend eingreifen, Prioritäten klären und Kompromissräume gestalten. -
Kontinuierliche Anpassung und Lernen
Die organisatorische Interaktion ist kein statisches Konstrukt. Durch Projekte, Änderungen, neue Technologien etc. verändern sich Anforderungen. Die Managementstrukturen und Kommunikationsströme müssen regelmäßig reflektiert und optimiert werden.
Beispiele aus der Praxis
-
In einem Luft- und Raumfahrtprojekt wurde früh ein fächerübergreifendes Architekten-Gremium geschaffen, in dem Mechanik, Elektronik, Software, Thermik und Qualität vertreten sind. Dieses Gremium definiert gemeinsam Architekturaspekte, Schnittstellen und kritische Wechselwirkungen.
-
In Automobilprojekten entstehen häufig Fehler, wenn die Software die Schnittstellen zur Hardware ändert, ohne dass Systemingenieure, Test und Hardware gemeinsam abgestimmt haben – ein klassischer Fall, in dem mangelndes Disziplinmanagement zu Nacharbeiten führt.
-
Bei einer Elektronik-Produktentwicklung wurde ein „Disziplin-Brücken-Team“ eingeführt, das regelmäßig zwischen Design, Fertigung und Test vermittelt, um frühe Fertigungstauglichkeitsprobleme zu antizipieren.
Herausforderungen und Empfehlungen
-
Widerstände und Silodenken: Einzelne Disziplinen wollen Autonomie und Fach-Vorrechte. Hier helfen klare Vorgaben aus der Geschäftsführung, Rollenbeschreibung und Nutzenkommunikation.
-
Skalierung in großen Organisationen: Bei vielen Disziplinen und Subteams kann das Management des Zusammenspiels komplex sein – hier hilft ein Big-Room-Planning und eine Transformation des Mindsets.
-
Zeit- und Ressourcenaufwand: Das Management dieser Arbeit kostet Aufwand – aber der Nutzen (verringerte Rework-Kosten, geringere Schnittstellenfehler) übersteigt meist die Investition.
-
Führung und Kultur: Letztlich ist das Prinzip auch eine Führungsaufgabe. Die Kultur der Zusammenarbeit und des disziplinübergreifenden Denkens muss von Führungskräften getragen werden.
Fazit
Das vierzehnte Prinzip hebt den Blick über rein technische Systemintegration hinaus und lenkt ihn in die Organisation selbst: Wer technisch integrative Systeme gestalten will, muss auch die Interaktion der beteiligten Disziplinen steuern. Nur so werden technische Lösungen kohärent, robust und effizient realisierbar.
➡️ Mit meinem Systems-Engineering-Mentoring helfe ich Dir, genau diese Brücken zwischen Disziplinen zu schlagen. So bringst Du Deine Entwicklungsteams in echte Systemdynamik – und Deine Produkte schneller zum Markt.